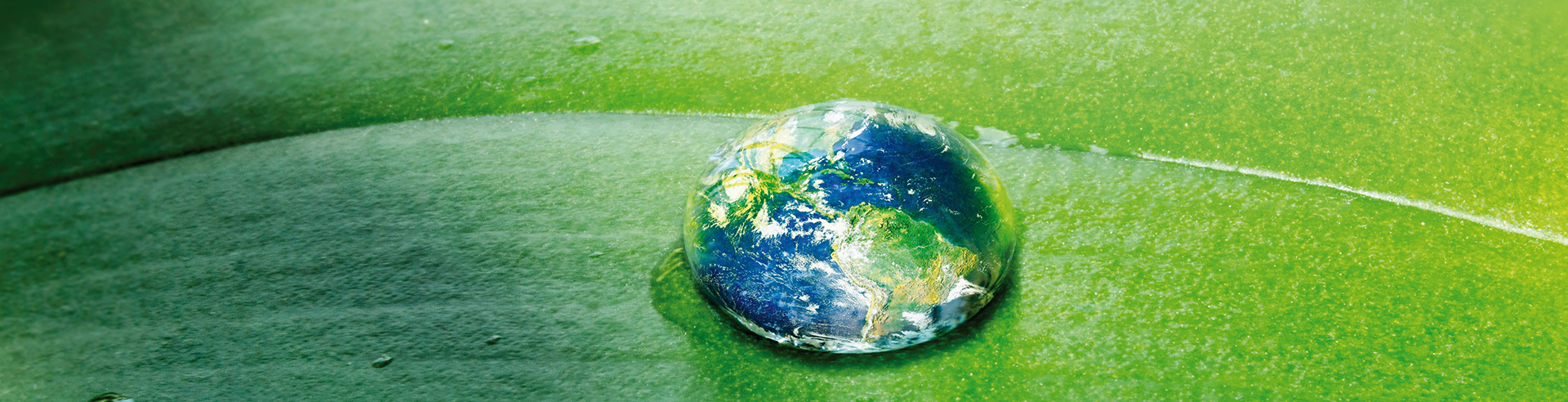Mitte Juli in der tibetischen Gemeinde Mêdog, einem der abgelegensten Orte der Welt: Spatenstich für ein Großprojekt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in China, einem Land, in dem ein Extrembauwerk das Nächste jagt. Diesmal allerdings geht es nicht einfach um ein großes, nein, nicht einmal um ein riesiges Projekt. Für das Motuo Hydropower Project bräuchte man ganz andere Adjektive: gigantisch, gewaltig, kolossal. Konzipiert als größte Wasserkraftanlage der Welt sollen insgesamt fünf aufeinanderfolgende Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 60 GW entstehen – mehr als das Hundertfache des größten Laufwasserkraftwerks Österreichs, dem Verbund Kraftwerk in Altenwörth, welches vergleichsweise gerade einmal 0,3 GW Leistung aufweist. 300 TWh Strom sollen jedes Jahr produziert werden, damit könnte der Stromverbrauch von ganz Österreich etwa vier Jahre lang gedeckt werden. Das Regelarbeitsvermögen wäre damit mehr als dreimal so groß wie im Dreischluchtendamm, dem aktuell größten Wasserkraftwerk der Welt, welches – wie könnte es anders sein – ebenfalls in China steht.
Milliardeninvestition in Wasserkraft
Möglich wird das Megaprojekt aufgrund der einzigartigen geographischen Gegebenheiten. Gelegen im Himalaya handelt es sich beim Fluss Yarlung Tsangpo, der in Indien erst Siang und dann Brahmaputra genannt wird und in Bangladesh als Jamuna bekannt ist, mit einer Länge von ca. 3.000 Kilometern und einer durchschnittlichen Höhenlage von ungefähr 4.000 Metern um den höchstgelegenen der 25 längsten Flüsse der Welt. Insgesamt liefern die Gletscher und Flüsse Tibets Wasser für 1,3 Milliarden Menschen, was für Yan Zhiyong, den Chef von PowerChina, vor allem eins bedeutet: „Die Region verfügt über die weltweit größten Ressourcen für Wasserkraft“. Der Yarlung-Tsangpo-Canyon, der das neue Kraftwerk beherbergen soll, ist zudem die tiefste an Land gelegene Schlucht der Welt, etwa dreimal so tief wie der Grand Canyon in den USA. Konkret soll das neue Kraftwerk an einer hufeisenförmigen Schlaufe dieser Schlucht gebaut werden, innerhalb welcher der Fluss auf einer Strecke von nur 50 Kilometern mehr als 2000 Höhenmeter abfällt. Hier sollen Tunnel entstehen, die das Wasser durch den Berg in der Mitte des Hufeisens transportieren und so den gewaltigen Höhenunterschied nutzbar machen.
Wie beim Ausbau vieler anderer Erneuerbaren-Technologien ist China auch bei der Wasserkraft Vorreiter. Mit mehr als 435 GW installierter Leistung erzeugte China 2024 1,424 TWh Strom aus Wasserkraft, mehr als jedes andere Land der Welt. Allein der Zubau von 14,4 GW im Jahr 2024 übersteigt die Gesamtkapazität Österreichs. Dafür wird in China viel Geld in die Hand genommen: 2023 hat China in einem Jahr mehr als 100 Milliarden Euro für den Ausbau von Erneuerbaren ausgegeben. Das neu geplante Kraftwerksprojekt soll sogar mehr als 140 Milliarden Euro kosten, wobei Expert*innen zusätzlich mit Investitionen von ca. 92 Milliarden Euro für den Netzausbau rechnen. Kein Wunder also, dass das Projekt Börsenkurse und Wachstumsprognosen gleichermaßen in die Höhe treibt.
Das Investitionsvolumen und die lange Planungszeit – offiziell wurde das Projekt 2020 angekündigt, inoffiziell dürfte es aber schon deutlich älter sein mögen in Österreich und Deutschland unvorstellbar scheinen, doch eigentlich zeigt das Reich der Mitte damit, wofür Kleinwasserkraft Österreich schon lange eintritt: Der Ausbau der Erneuerbaren – und damit die Energiewende – kann gelingen, wenn nur ausreichend politischer und finanzieller Wille vorhanden ist.

Zwangsumsiedelungen und Biodiversität
Allerdings haben sowohl der steigende Energiebedarf in China sowie das Projekt in Mêdog auch Schattenseiten. Gleichzeitig mit der Wasserkraft werden in China nämlich auch hunderte neue Kohlekraftwerke gebaut, um trotz wachsendem Anteil volatiler erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne die Stromversorgung garantieren zu können. Insgesamt stammen in China, dem weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen, trotz starken Wachstums der Erneuerbaren immer noch über 55% des Stromverbrauchs aus Kohle. Was das Projekt in Mêdog betriff, so gibt es neben dem wohlbekannten Spannungsfeld der Ökologie auch Bedenken betreffend Kulturgütern und Sicherheit.
Der Yarlung-Tsangpo-Canyon ist einer der wichtigsten Biodiversitätshotspots des Planeten. Dank der einzigartigen Topografie finden sich dort auf kleinstem Raum eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Lebensräumen, von Gletschern und Almweiden bis hin zu tropischen Regenwäldern. Neben dem größten und ältesten Baum Asiens – einer über 100 Metern hohen Himalaya- Zypresse – beherbergt die Region auch eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten, darunter die einzige in China bekannte Königstigerpopulation. Versuche, die Schlucht in einen Nationalpark zu verwandeln, sind vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich.

Gleichzeitig ist die Region um den Yarlung-Tsangpo- Canyon auch von großer kultureller und spiritueller Bedeutung für die Einheimischen, denen die Berge, Wälder und Flüsse heilig sind. So wird beispielsweise der Yarlung Tsangpo selbst als irdische Gestalt der tibetischen Göttin Dorje Pagmo angesehen. Neben Sorgen wie der Zwangsumsiedelung tibetischer Bewohner*innen zählt auch die Angst vor Erdbeben zu den Bedenken der Kritiker*innen. Denn der vorgeschlagene Projektstandort ist Treffpunkt von zwei bedeutenden tektonischen Platten und Schauplatz reger seismischer Aktivität. Erst im Januar wurde Tibet von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 nach Richter erschüttert. Auch das stärkste je an Land verzeichnete Erdbeben, ein Beben der Stärke 8,6 nach Richter, ereignete sich 1950 nur wenige hundert Kilometer entfernt von den aktuell geplanten Anlagen. Zusätzlich zu der Gefahr von Dammbrüchen sind die Nachbarländer Indien und Bangladesch auch über die geopolitischen Auswirkungen des Projekts besorgt. China könnte mit dem Staudamm unweit der indischen Grenze in die Wasserversorgung Indiens eingreifen und diese als politisches Druckmittel bei Dürren und Überschwemmungen verwenden, so die Befürchtung. Wegen der starken Regenfälle im Einzugsgebiet des Flusses in Indien, Bhutan und Bangladesch wird der Anteil Chinas am Wasser des Yarlung-Tsangpo zwar nur auf 7 bis 30 % geschätzt, Indien überlegt dennoch, einen eigenen Staudamm inklusive Kraftwerk zu bauen, um den Wasserfluss selbst regulieren zu können.
Fazit
Das Motuo Hydropower Project ist ein enormes Unterfangen, das die moderne Technik an den Rand des Machbaren führt und so Chinas Führungsanspruch beim Ausbau der Erneuerbaren untermauert. Themen, die bei Kleinwasserkraftwerken unweigerlich zur Diskussion stehen, sieht man hier, wenn auch weitaus komplexer, auf internationaler Ebene. Zeitgleich verdeutlicht das Projekt aber auch das große Potenzial der Wasserkraft. Es lässt erahnen, was auch anderenorts möglich wäre – mit den richtigen Rahmenbedingungen und genügend politischem Willen.