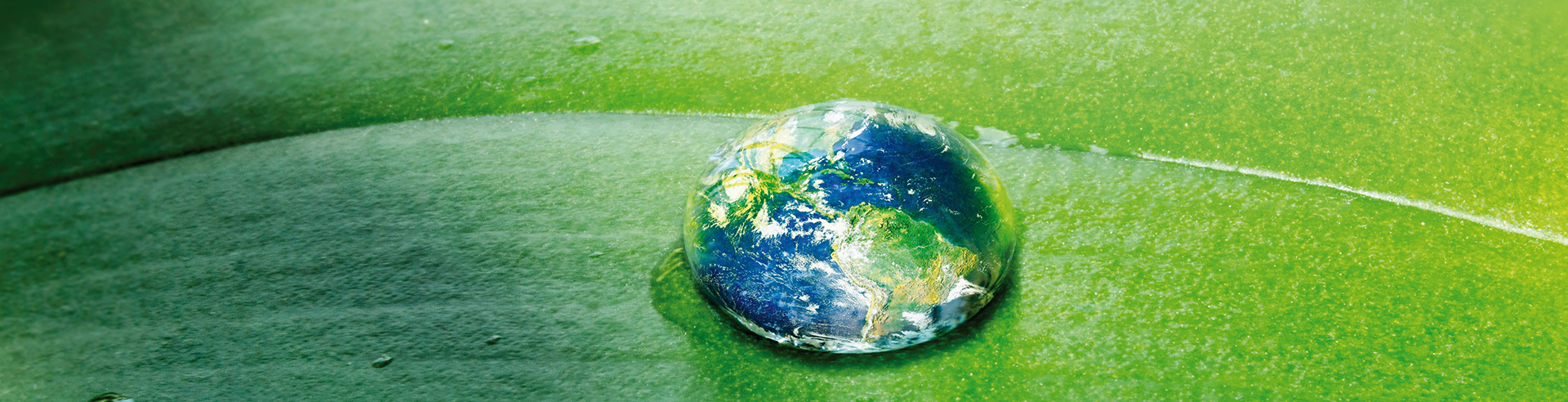Der Wärmesektor gilt als eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Mit einem Anteil von rund 56% am Endenergieverbrauch ist die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser der größte Einzelposten im Energiebedarf. Derzeit werden jedoch mehr als 86,8% dieser Wärme durch fossile Energieträger gedeckt. Die deutsche Bundesregierung verfolgt daher das Ziel, die Wärmeerzeugung sukzessive zu dekarbonisieren. Hierzu bedarf es innovativer Lösungen, insbesondere für urbane Räume mit hoher Energiedichte. Das Forschungsprojekt „Hydro2HEAT“ der Technischen Universität Braunschweig untersuchte in diesem Zusammenhang die Rolle von Aquathermie – also der Wärmegewinnung aus Fließgewässern – als strategisch relevante erneuerbare Energiequelle.
Hintergrund und Motivation
Deutschland verfügt über ein dichtes Netz an Flüssen und Bächen mit einer Gesamtlänge von über 400.000 Kilometern – mehr als zehnmal so lange wie der Äquator. In unmittelbarer Nähe zu diesen Gewässern befinden sich zahlreiche Städte, Industriegebiete und Wohnsiedlungen. Genau hier setzt Aquathermie an: Die thermische Energie, die im Flusswasser gespeichert ist, kann mittels Wärmetauschern und Großwärmepumpen entzogen und auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben werden. Im Gegensatz zu geothermischen oder solaren Quellen sind Fließgewässer in vielen Fällen direkt zugänglich und gut in bestehende Infrastrukturen integrierbar. Das Projekt „Hydro2HEAT“ analysierte die Nutzungspotenziale für 80 deutsche Großstädte und legte dabei den Fokus auf technische, ökologische und wirtschaftliche Aspekte.
Methodik und Datenbasis
Für die Potenzialermittlung wurden hydrologische Daten zu Temperatur, Durchflussmenge und Fließgeschwindigkeit ausgewertet. Zudem flossen städtebauliche Daten, wie der mittlere Wärmebedarf pro Einwohner, in die Berechnung ein. Das Projektteam nutzte Kartierungsverfahren, um die räumliche Nähe von Flüssen zu bestehenden Wärmenetzen zu bestimmen. Zusätzlich wurde analysiert, welche bestehenden Wasserkraftanlagen sich für eine Doppelnutzung im Sinne von Wasser-Wärme-Kraftwerken eignen würden. Ziel war es, das technisch erschließbare sowie das ökologisch vertretbare Potenzial präzise abzuschätzen.
Die Funktionsweise von Aquathermie
Aquathermie bezeichnet die Nutzung thermischer Energie aus Oberflächengewässern zur Deckung von Heiz-und Kühlbedarfen. Je nach Standortbedingungen können unterschiedliche aquatische Wärmequellen erschlossen werden, darunter Fließ- und Stillgewässer, geklärtes Abwasser sowie Meerwasser. Trotz der vergleichsweise niedrigen Temperaturprofile dieser Medien erlaubt der Einsatz von Wärmetauschern in Kombination mit Wärmepumpentechnologie eine energetisch effiziente Nutzung. Zur thermischen Erschließung wird das Wasser durch einen Wärmetauscher geführt, in dem die enthaltene Niedertemperaturwärme auf ein sekundäres Medium, in der Regel ein zirkulierendes Kältemittel, übertragen wird. Dieses wird anschließend in der Wärmepumpe komprimiert, wodurch das Temperaturniveau so weit angehoben wird, dass es für die Gebäudebeheizung oder die Einspeisung in ein Nah- bzw. Fernwärmenetz geeignet ist. Alternativ kann die erzeugte Nutzwärme unmittelbar für die Trinkwarmwasserbereitung verwendet werden. Die energetische Effizienz solcher Systeme wird über die Jahresarbeitszahl (JAZ) quantifiziert, die das Verhältnis der abgegebenen thermischen Energie zur eingesetzten elektrischen Energie beschreibt. Typische Wärmepumpenanlagen erreichen JAZ-Werte zwischen 2,5 und 5,0, abhängig von Systemkonfiguration, Quelltemperatur und Nutztemperaturniveau. Eine JAZ von 4 bedeutet beispielsweise, dass pro eingesetzter Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme bereitgestellt werden.

Ergebnisse der Potenzialanalyse
Die Untersuchung zeigt, dass für 41 der 80 untersuchten Städte der gesamte Raumwärmebedarf für Haushalte, Industrie, Dienstleistung, Handel und Gewerbe zu 100% und mehr aus Fließgewässern gedeckt werden könnte. Weitere 17 Städte könnten ihren Bedarf zu mehr als 50% aus Fließgewässern decken.
Vor allem Städte, die an großen Flüssen wie Rhein, Donau und Elbe mit konstanten Durchflussraten liegen, weisen ein großes Nutzungspotenzial auf. Das gesamte technische Fließgewässerwärmepotenzial in Deutschland liegt der Studie nach bei rund 2.692,3 TWh pro Jahr. Damit ist das grundsätzlich technisch nutzbare Wärmepotenzial der Fließgewässer größer als der gesamte Endenergiebedarf von Deutschland im Jahr 2021 mit 2.410,7 TWh. Zusätzlich wird das gesamte theoretische Potenzial der Abwasserwärme auf 157,1 TWh und das technische Potenzial auf 44,9 TWh pro Jahr geschätzt. Durch den Klimawandel steigt in Deutschland das nutzbare Wärmepotenzial der Fließgewässer kontinuierlich an. Ursache hierfür sind höhere Jahresmitteltemperaturen und steigende Abflüsse. Im Hinblick auf die Langzeittrendlinien der Jahresmitteltemperatursteigerung ist je nach Fließgewässer bis 2050 von einer weiteren Zunahme der Jahresmitteltemperatur um 1°C auszugehen. Dies würde das technisch nutzbare Fließgewässerwärmepotenzial in Deutschland auf 2.908 TWh pro Jahr erhöhen.
Ökologische Bewertung
Ein zentraler Aspekt des Projekts war die Untersuchung ökologischer Auswirkungen. Aquathermie kann bei fachgerechter Umsetzung ökologische Vorteile mit sich bringen. Insbesondere in Sommermonaten, wenn Flüsse durch klimawandelbedingte Hitzeperioden unter Sauerstoffmangel leiden, kann bereits eine geringe Abkühlung zu einer lokal verbesserten Wasserqualität führen. Zusätzlich entziehen die im Wasser verankerten Wärmetauscher dem Flusswasser Wärmeenergie und leiten es abgekühlt zurück. Fließgewässersysteme wirken zusätzlich als großflächige Wärmetauscher: Entlang ihres Verlaufs nehmen sie Wärme aus der Umgebung auf und können sich nach einem Wärmeentzug durch die Aquatermie erneut erwärmen. Je kühler das Wasser, desto mehr Umweltwärme lässt sich entziehen. Vor allem in städtischen Gebieten können Flüsse so größere Wärmemengen aufnehmen und zur lokalen Abkühlung beitragen – ein wichtiger Effekt angesichts der zunehmenden Erwärmung durch den Klimawandel. Durch die Wiedererwärmung ist zudem eine mehrfache Nutzung der Fließgewässerwärme entlang des Gewässerverlaufs möglich. Untersuchungen an Fließgewässern zeigen eine ökologisch mögliche Temperaturspreizung an einem Standort von 2 bis 3 Kelvin, die noch als ökologisch verträglich einzustufen ist. Daher beträgt das ökologisch nutzbare Fließgewässerwärmepotenzial für Deutschland zwischen 860 und 900 TWh pro Jahr.
Internationale Perspektive
Andere europäische Länder, wie die Niederlande oder die Schweiz, haben bereits erfolgreiche Aquathermie-Projekte umgesetzt. In Rotterdam deckt ein großes Wärmenetz seinen Bedarf teilweise aus Flusswasser, während in Genf ein ganzer Stadtteil bereits an ein aquathermisches System angeschlossen ist. Diese internationalen Beispiele zeigen, dass die Technologie praxistauglich ist. Auch Österreich hat die hydrologischen Voraussetzungen für die Aquathermie. Angenommen werden kann, dass aufgrund ihrer Größe die Donau, Inn, Enns, Salzach und Mur jedenfalls geeignet sind.
Wärmegewinnung aus Wasserkraftanlagen
Zusätzlich wurde die Wärmegewinnung aus Wasserkraftanlagen in den 80 Großstädten untersucht. Die Untersuchung zeigt, dass die Wasserkraft über ihren bisherigen Einsatz zur Stromerzeugung hinaus auch für die Gewinnung von grüner Nah- und Fernwärme aus Fließgewässern genutzt werden kann. Durch diese doppelte Funktion eröffnen sich völlig neue Perspektiven für den zukünftigen Einsatz der Wasserkraft. In Zukunft können auch Laufwasserkraftwerke als grundlastfähige, speicherbare und regelbare erneuerbare Energiequelle eine zentrale Rolle sowohl in der Strom- als auch in der Wärmeversorgung übernehmen und zugleich wichtige Systemdienstleistungen in einem nachhaltigen Energiesystem bereitstellen. In 59 der 80 untersuchten Städte sind insgesamt 271 Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 298,42 MW in Betrieb. Diese Anlagen erzeugen jährlich 1,42 TWh Energie. Ein Beispiel für eine derzeit stillgelegte Wasserkraftanlage ist die WKA-Auermühle in Leverkusen. Die potenzielle elektrische Leistung beträgt 36 kW. Bei einem Mittelwasserstand und einem Ausbaudurchfluss von 2,3 m³/s könnte die thermische Leistung 19 MW erreichen, was während der Heizperiode (1. Oktober bis 30. April) zu einer Wärmeerzeugung von 97.640 MWh führen würde. Im Falle einer Reaktivierung der Anlage könnten damit mehr als 10% der knapp 83.500 Haushalte in Leverkusen mit Raumwärme versorgt werden. Zusätzlich könnte der erzeugte Strom rund 72 Haushalte mit Energie versorgen. Die Untersuchungen verdeutlichen, dass bereits kleine Wasserkraftanlagen mit einer elektrischen Leistung von 5 bis 10 kW in der Lage sind, beträchtliche Wärmeleistungen im Bereich von 1 bis 10 MW und darüber hinaus bereitzustellen. Diese Anlagen haben somit das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Wärmeversorgung von Städten und Gemeinden zu leisten.
Fazit
Aquathermie stellt nicht nur ein visionäres Konzept, sondern auch eine praktikable Lösung für die Wärmewende dar. Um dieses große Potenzial zu heben, ist der Ausbau der Forschung und Entwicklung von kombinierten Wasser-Wärme-Kraftwerken erforderlich. Das vorhandene Potenzial lässt sich durch die Nutzung bestehender Wasserkraftanlagen zügig und effizient erschließen. Diese Anlagen besitzen bereits eine wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Wasser zur Stromerzeugung und verfügen zudem über die nötige technische Infrastruktur für die Wasserentnahme. Die Nähe zu Städten, die gute ökologische Bilanz und die technische Machbarkeit sprechen für eine stärkere Berücksichtigung in politischen und planerischen Entscheidungen. Nicht nur Deutschland hat das Potenzial, sondern auch Österreich, es muss nur genutzt werden.