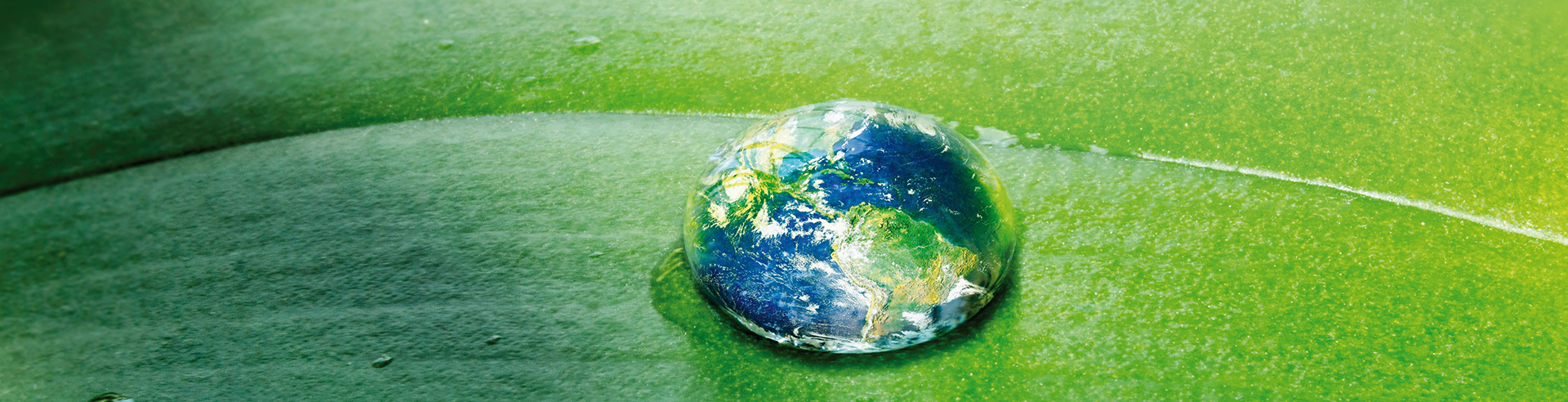Warum die Atmosphäre trotz Erwärmung austrocknet
Die globale Erwärmung führt dazu, dass die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. Nach dem physikalischen Clausius-Clapeyron-Gesetz steigt die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf zu halten, bei höheren Temperaturen exponentiell an. Pro Grad Celsius Temperaturanstieg kann die Luft rund sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Dieser Zusammenhang ist grundlegend für das Verständnis von Feuchtigkeits- und Klimaphänomenen wie der Verdunstung, Wolkenbildung und Niederschlagsmustern.
Paradoxerweise zeigen wissenschaftliche Beobachtungen, dass die relative Luftfeuchte – also das Verhältnis zwischen der tatsächlich enthaltenen und der maximal möglichen Feuchtigkeitsmenge – in einigen Landregionen abnimmt. Wie kann die Luftfeuchte über Land abnehmen, wenn das atmosphärische Wasseraufnahmepotenzial zunimmt? Das Verhalten der Atmosphäre hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehaltes ist ein entscheidender Faktor, um zukünftige Wasserverfügbarkeiten, Dürregefahren und das Vorkommen von Wasser- und Energiereserven vorherzusagen. Der Unterschied zwischen Klimamodellen und Beobachtungen lässt die Wissenschaft nach Gründen für die Austrocknung und die Rolle der Verdunstung suchen.
Die Evapotranspiration
Die Atmosphäre spielt eine entscheidende Rolle für Wasserressourcen und damit auch für die Wasserkraft, da sie den Wasserkreislauf durch Verdunstung, Wolkenbildung und Niederschlag antreibt. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft bestimmt, wie viel Regen in einer Region fällt, was die Wasserversorgung in Flüssen, Seen sowie den Grundwasserspiegel beeinflusst. Gleichzeitig ist die Verdunstung von Wasser aus Böden, Pflanzen und Wasserflächen ein wichtiger Bestandteil dieses Kreislaufs. Wenn man von Evapotranspiration (ET) spricht, sind damit zwei Mechanismen gemeint, mit denen Wasser in die Atmosphäre gelangen kann. Wenn Wasser direkt aus dem Boden, Wasserflächen und Oberflächen verdampft, spricht man von Evaporation. Die andere Möglichkeit ist, wenn Wasser, welches durch Pflanzen aufgenommen wird, in den Blättern verdampft und an die Luft abgegeben wird. Pflanzen nehmen Flüssigkeit über ihre Wurzeln auf und transportieren diese aus dem Boden in ihre Blätter – man spricht hierbei von Transpiration. ET fasst beides zusammen und ist somit ein Schlüsselmechanismus, um Wasser von Landflächen in die Atmosphäre zu transferieren.
Wie trocknet ET die Atmosphäre aus
In der Forschung wird schon länger nach den Ursachen für den rückläufigen Feuchtigkeitsgehalt über Landflächen gesucht. Bisherige Erklärungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die unzureichende Wasserversorgung der Ozeane und vernachlässigten die Rolle der Evapotranspiration. Steigt die ET, sorgt das kurzfristig für eine höhere Luftfeuchtigkeit und das leicht verfügbare Wasser wird an die Luft abgegeben. Wenn in einem Gebiet die Pflanzen über längere Zeit viel Wasser verdampfen, reduziert das insgesamt die Bodenfeuchte. Weniger verfügbares Wasser im Boden bedeutet, dass weniger Wasser für zukünftige ET-Prozesse vorhanden ist und die Atmosphäre somit austrocknet. In einer Umgebung mit begrenztem Wasserangebot führt also eine hohe ET dazu, dass die Böden austrocknen und dadurch die Gesamtmenge an Wasser, welches in die Luft gelangen kann, sinkt. Dies ist meist ein regionales Problem, denn das Wasser verschwindet nicht, sondern wird in andere Gebiete transportiert.
Auswirkungen der Austrocknung auf das Wasser- und Klimasystem
Laut einer Studie der Universität Columbia kann die Austrocknung der Atmosphäre über Land verschiedene signifikante Auswirkungen haben – sowohl lokal als auch global. So erhöht trockene Luft das Dürre- und Brandrisiko, die Gefahr von Waldbränden und Ernteausfällen steigt. Weniger Wasser in der Atmosphäre bedeutet auch, dass es weniger Niederschlag in der Region gibt, was die Wasserknappheit weiter verstärkt. Trockene Bedingungen können auch zu lokalen Temperaturanstiegen führen, da Feuchtigkeit in der Luft eine kühlende Wirkung hat. Pflanzen und Tiere sind ebenfalls auf bestimmte Feuchtigkeitsniveaus angewiesen und die Biodiversität sowie die Stabilität der Böden werden davon beeinflusst.
Weniger Wasser befeuert auch den Klimawandel. Die fehlende Feuchtigkeit hat eine direkte Auswirkung auf die Fähigkeit der Erde, Wärme zu speichern und abzuleiten. Wasser speichert Energie, weil es eine hohe Wärmekapazität hat. Die Wärmekapazität beschreibt, wie viel Wärme (also Energie in Joule) man einem Stoff zuführen muss, um seine Temperatur zu erhöhen. Je höher die Wärmekapazität, desto mehr Energie braucht man, um den Stoff zu erwärmen. Das heißt, Wasser kann große Mengen an Wärme aufnehmen, ohne die Temperatur stark zu verändern. Herrscht jedoch Wasserknappheit, steigen die Temperaturen, weil der Boden und die Pflanzen Wärme nicht mehr effizient abführen können. Gleichzeit verdunstet weniger Wasser und die kühlende Wirkung bleibt aus. Die Temperaturen steigen somit weiter und Trockenheit verstärkt sich, da das Wasser als natürlicher Puffer fehlt. Dieser Prozess führt zu einem sich selbst verstärkenden Teufelskreis aus Trockenheit, Hitze und Wasserverlust.
Evapotranspiration verstehen – Wasserressourcen sichern
Der Feuchtegehalt der Atmosphäre bestimmt Niederschlag, Verdunstung und Wolkenbildung, welche wiederum maßgeblich für die Wasserversorgung von Seen, Flüssen und Grundwasser sind. Eine Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit kann somit eine große Auswirkung auf die lokal verfügbaren Wasserressourcen haben und die Wasserzufuhr in Flüssen verringern – ein Problem, wovon auch die Wasserkraftproduktion betroffen sein kann. Das Verständnis der Rolle von Evapotranspiration im Wasserkreislauf ist essenziell, um die langfristige Verfügbarkeit von Wasserressourcen zu sichern. Damit werden auch präzisere Vorhersagen für die Wasserkraft möglich, was langfristig zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung beiträgt.