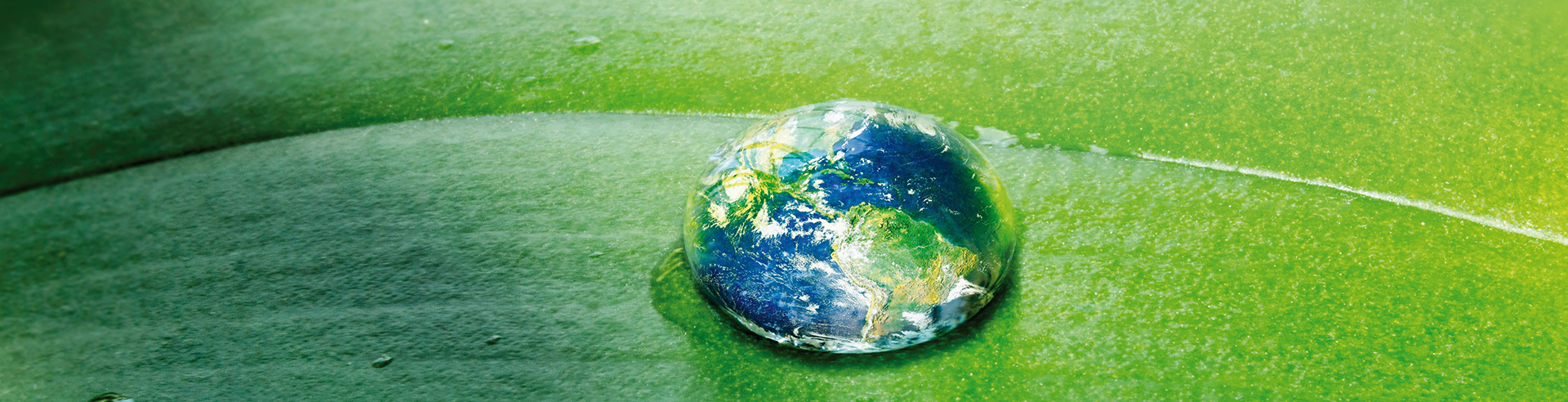Ursula von der Leyens erste Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission war geprägt vom European Green Deal, einer umfassenden Strategie, welche die EU in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit führen soll. In ihrer zweiten Amtszeit steht dessen Nachfolger, der Clean Industrial Deal, im Mittelpunkt, der die Ziele der Dekarbonisierung und der Wettbewerbsfähigkeit in einer kohärenten Wachstumsstrategie zusammenführen soll. Der Ende Februar 2025 veröffentlichte Clean Industrial Deal sieht unter anderem vor, die Erschwinglichkeit von Energie zu verbessern, Investitionen in Erneuerbare Energien zu mobilisieren und Europas industrielle Stärke und Führungsrolle bei der Energiewende wiederherzustellen.
Parallel zu diesen neuen EU-Initiativen und Entwicklungen in der Gesetzgebung müssen die nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten die jüngsten EU-Rechtsvorschriften im Rahmen des Green Deals in nationales Recht umsetzen. Es muss hervorgehoben werden, dass die meisten dieser europäischen Rechtsvorschriften, wie die überarbeitete Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III), zur Förderung der Wasserkraft genutzt werden kön- Die Förderung der Rolle der Kleinwasserkraft in Europa Die Europäische Union steht vor der Herausforderung, ihre Energiesysteme zu transformieren und die Klimaziele zu erreichen. In diesem komplexen Umfeld gewinnt die Kleinwasserkraft zunehmend an Bedeutung – nicht nur als erneuerbare Energiequelle, sondern auch als strategischer Akteur für Netzstabilität, Energiespeicherung und Ökosystemerhaltung. nen. Die endgültige Entscheidung und der Umfang darüber liegen jedoch in der Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten.
Die Mitgliedstaaten sollten alle Möglichkeiten im Rahmen der RED III nutzen, um die Wasserkraft zu fördern
Trotz der neuen Formulierung „Clean Industrial Deal“ sieht die Europäische Kommission den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien (und der Energieeffizienz) als ein wichtiges Instrument, um die Energieunabhängigkeit Europas zu ermöglichen und preiswerte Energie für Industrie und Privathaushalte zu liefern.
Die revidierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) spielt dabei eine zentrale Rolle. Trotz dieser Bemühungen und Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Herausforderungen für die Entwickler*innen von (Klein-) Wasserkraftwerken. Dazu gehören die verzögerte Umsetzung der RED III, Vorgaben zu umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen und der fehlende politische Wille von nationalen Entscheidungsträger*innen, die Chancen und Vorteile von Kraftwerksprojekten zu nutzen.
Trotz der Anerkennung der Erneuerbaren Energien als übergeordnetes öffentliches Interesse haben viele Akteur*innen der Wasserkraft ihre Frustration über die anhaltenden administrativen und legislativen Hürden zum Ausdruck gebracht. Es ist an der Zeit, dass die nationalen Regierungen die Möglichkeiten nutzen, welche die EU-Gesetzgebung für den Wasserkraftsektor bietet.
Möglichkeiten der Kleinwasserkraft für die Speicherung
Die Anerkennung der Kleinwasserkraft als wichtige erneuerbare Energiequelle ist von entscheidender Bedeutung, da sie zur Flexibilität, Energiespeicherung und zum Engpassmanagement beitragen kann. Diese Vorteile machen sie zu einem wichtigen Akteur, der die Integration flexibler erneuerbarer Energiequellen wie Photovoltaik und Windkraft ermöglicht und gleichzeitig zur Dezentralisierung und Stabilität des Stromnetzsystems beiträgt. Parallel zu den Überlegungen der Europäischen Kommission, ihre Empfehlung zur Energiespeicherung zu aktualisieren, untersuchen Projektentwickler*innen und Entscheidungsträger*innen die Möglichkeiten kleiner und mittelgroßer Pumpspeicherkraftwerke, die regionale Kapazität für den Energieverbrauch zu verbessern. Die European Renewable Energies Federation (EREF) und seine Arbeitsgruppen sind dabei, Empfehlungen für Entscheidungsträger- *innen zu entwickeln und Best- Practice-Beispiele zu präsentieren.
Umsetzung der EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur
Parallel zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für Erneuerbare Energien (Renewable Acceleration Areas, RAA) in den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der RED III sind die Regierungen durch die Umsetzung der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Regulation, NRR) verpflichtet, bis Anfang September 2026 nationale Wiederherstellungspläne (NRP) zu entwickeln. Die Verordnung trat am 18. August 2024 in allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Sie setzt rechtsverbindliche Ziele für die Wiederherstellung von 20% der geschädigten Land- und Meeresökosysteme der EU bis 2030 und für alle bedürftigen Ökosysteme bis 2050. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 mindestens 30% der unter die NRR fallenden Lebensräume von einem schlechten in einen guten Zustand bringen, bis 2040 – 60% und bis 2050 – 90%. Dabei wird Gebieten in Natura-2000-Gebieten Vorrang eingeräumt.
Die Verordnung sieht unter anderem bis 2030 die Wiederherstellung von 25.000 km so genannten frei fließenden Flüssen vor. Regierungen müssen in ihren nationalen Wiederherstellungsplänen Sanierungsgebiete festlegen und Maßnahmen auflisten, wie sie Habitate und Flussökosysteme in den nächsten zwei Jahrzehnten verbessern wollen. Die EU-Mitgliedstaaten müssen für Synergien mit der RED III sorgen und ihre nationalen Sanierungspläne mit der Kartierung der Gebiete koordinieren, die für den nationalen Beitrag zur Erreichung des EU-Ziels von mindestens 42,5% Erneuerbarer Energien bis 2030 erforderlich sind.
Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einer Beeinträchtigung des Ökosystems vorzubeugen, gilt nicht für Beeinträchtigungen, die durch Projekte für Erneuerbare Energien, ihren Anschluss an das Netz und das Netz selbst sowie durch Speicheranlagen außerhalb von Natura-2000-Gebieten verursacht werden. Dies gilt auch für die Wasserkraft. Die Europäische Kommission ist dabei, den nationalen Regierungen Hilfestellung zu geben, wie sie solche Pläne am besten entwickeln können. Für die kommenden Wochen ist eine Durchführungsverordnung geplant, gefolgt von einer erläuternden Broschüre und einem Online-Referenzportal mit den unterstützenden Dokumenten.
Eines der Hauptziele der Verordnung ist die Einrichtung von 25.000 km sogenannter frei fließender Flüsse. Die Wasserrahmenrichtlinie enthält bereits eine Definition der ökologischen Durchgängigkeit von Flüssen als wichtiges biologisches Stützelement. Im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie (CIS) der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) entwickelt die Kommission jedoch in Absprache mit Regierungen und Interessenvertretern, einschließlich EREF und seiner Mitglieder, eine neue Methodik zur Schaffung frei fließender Flüsse, indem sie Fallstudien zu verschiedenen Flusstypen in Europa durchführt.
Nach der Fertigstellung im Herbst 2025 plant die Kommission, diese neue Methodik für die Umsetzung der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur zu verwenden. Die Absicht, die Methodik für frei fließende Flüsse als CIS-Leitfaden zu veröffentlichen, spiegelt die Position der Kommission in Bezug auf die Auslegung der Definition von „frei fließenden Flüssen“ in Artikel 3 der Verordnung zur Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume wider. Parallel dazu plant die EU-Kommission für 2025, weitere nationale Beispiele zu sichten, um bewährte Verfahren und Maßnahmen zu ermitteln. Ein Diskussionspapier auf Grundlage der ersten gemeldeten Fälle und ein Stakeholder-Workshop über bewährte Praktiken bei ökologischen Durchflüssen (dies beschreibt die Menge, den Zeitpunkt und die Qualität von Wasserströmen, die für die Erhaltung von Süßwasser- und Ästuar-Ökosystemen sowie für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen der Menschen, die von diesen Ökosystemen abhängen, erforderlich sind) ist für Ende 2025 geplant. Ein Abschlussbericht und Empfehlungen sind für Ende 2026 vorgesehen.
EREF und seine Mitglieder werden erneut Best-Practice- Beispiele und Empfehlungen aus dem Bereich der Kleinwasserkraft bereitstellen. Unter anderem leitet EREF die Arbeitsgruppe zum Thema Biodiversität des ETIP-Wasserkraftprojekts und sammelt Erkenntnisse von Akteur*innen und Expert*innen aus dem Bereich der Wasserkraft zu diesen Themen. Die daraus resultierenden White Papers inklusive Empfehlungen für politische und rechtliche Änderungen zur Beschleunigung des Ausbaus der Wasserkraft werden der Europäischen Kommission und dem Parlament vorgelegt.
Die europäischen (Klein-)Wasserkraftanlagen zeigen, dass Stromerzeugung und der ökologische Zustand eines Flusses harmonisch Hand in Hand gehen können. Die meisten Wasserkraftanlagen verfügen über fortschrittliche Technologien und bewährte Managementpraktiken zur Förderung des ökologischen Zustands von Flüssen, wie z.B. Fischaufstiegssysteme, spezielle Turbinen und Kompromisse zwischen Durchfluss und Energieerzeugung.
In der Anlage Hafslund-Hunderfossen am Fluss Gudbrandsdalslågen in Norwegen wurde beispielsweise 2023 eine Reihe innovativer Maßnahmen eingeführt, die zu einer rekordverdächtigen Fischwanderung seit dem Bau des Damms führten.
Dazu gehören optimierte Schleusensysteme, welche die Fischwanderung verbessern sollen, und die Installation neuartiger, automatischer Fischzähler an den Fischtreppen. Solche Maßnahmen unterstreichen das Engagement des Wasserkraftsektors, umweltfreundliche Maßnahmen in die erneuerbare Energieerzeugung zu integrieren. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Kleinwasserkraftwerke zu neuen und seltenen Lebensräumen für Wasserlebewesen führen, was wiederum zu einer Verbesserung ihres ökologischen Gesamtzustands beiträgt.
EREF fordert nationale Regierungen auf, die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur so umzusetzen, dass Beitreiber*innen von Wasserkraftwerken nicht belastet werden. EREF wird weiterhin Best-Practice-Beispiele hervorheben und weitere Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinien analysieren, um sicherzustellen, dass die Rolle der Kleinwasserkraft bei der Energiewende in Europa nicht übersehen wird
Europäische Strategie für eine resiliente Wasserversorgung
Um sich besser an häufigere Wetterextreme wie Überschwemmungen und Dürren aufgrund des Klimawandels anpassen zu können, entwickelt die Europäische Kommission eine Strategie für eine resiliente Wasserversorgung. Sie zielt darauf ab, ausreichend, sauberes Wasser für alle zu gewährleisten, Ökosysteme zu schützen und die europäische Wirtschaft durch eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu stärken.
EREF hebt die Vorteile der Kleinwasserkraft für die Widerstandsfähigkeit des Wassers und die Klimaanpassung hervor. Neben der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen trägt die Wasserkraft zur Abschwächung von Wasserknappheit und zur Verhinderung von Überschwemmungen bei, indem sie die Wasserspeicherung und die Regulierung des Wasserflusses unterstützt. Die Sicherstellung dieser Leistungen ist jedoch häufig mit zusätzlichen Kosten für die Betreiber*innen verbunden.
EREF fordert daher die europäischen Entscheidungsträger* innen auf, die Doppelrolle der Wasserkraft bei der Energieerzeugung und der Bewirtschaftung der Wasserressourcen anzuerkennen. Es ist an der Zeit, dass die EU die Rolle der Kleinwasserkraft bei der Klimaanpassung anerkennt und dass die einzelnen Mitgliedstaaten eine angemessene Vergütung sicherstellen.
Dieser Artikel stammt von Dirk Hendricks, Generalsekretär von EREF. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Entwicklung der EU Energieunion und die Interessenvertretung des Kleinwasserkraftsektors. Zudem kümmert er sich um die Förderung von Erneuerbaren in der EU und Afrika. Dabei fungiert er als Bindeglied zwischen den nationalen Erneuerbaren Energieverbänden und den europäischen sowie internationalen Institutionen und Organisationen.