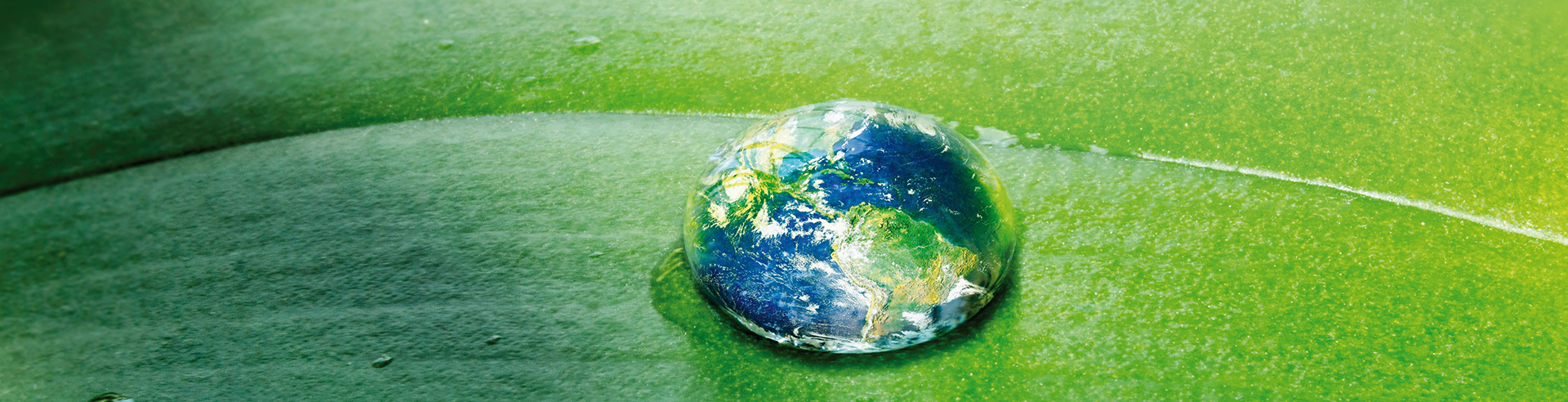Es gibt zwei grundsätzliche Arten des Monitorings: Verfahren, die ohne den Fang von Fischen auskommen, und solche, die einen Fang erforderlich machen. Beide Methoden bieten jeweils Vor- und Nachteile. Der Vorteil der fischschonenden Ansätze liegt darin, dass das natürliche Verhalten der Tiere nicht gestört wird und somit authentische Beobachtungen möglich sind. Je nach verwendeter Methode kann es jedoch schwierig sein, die Arten eindeutig zu bestimmen oder einzelne Individuen über längere Zeiträume hinweg zu verfolgen. Generell wirkt sich jeder Fang sowie anschließende Vermessungen oder Markierungen belastend auf die Tiere aus. Markierungs-Wiederfangstudien können das Fischmonitoring zudem erheblich ergänzen, indem sie alternative Schätzungen der Populationsgröße und des Fischalters liefern. Sie können auch das Ausmaß der Wanderungen einzelner Fische zwischen Habitaten innerhalb bestimmter Populationen aufzeigen. Fische werden unter anderem mit Farbpunkten, Schildchen, Flossenschnitt und Sendern markiert. Sender können äußerlich angebracht oder im Körper implantiert werden. Verfahren, die Fischbewegungen oder Wanderungen ohne Fang erfassen, beruhen auf physikalischen Prinzipien wie Optik, Elektrik oder Akustik.

Monitoring mittels Fischfang
Elektrobefischung
Die Elektrofischerei kann je nach Wassertiefe des untersuchten Flussabschnitts auf zwei Arten durchgeführt werden: entweder zu Fuß im Flachwasser (watend) oder mit Hilfe eines Bootes in tieferen Bereichen. In Gewässerabschnitten mit variierenden Tiefen wird oft eine Kombination beider Methoden eingesetzt. Die Elektrobefischung kann über die gesamte Flussbreite oder streifenförmig entlang des Fließgewässers erfolgen. Die Wahl zwischen Streifenbefischung und Befischung der gesamten Breite hängt von der Art des Gewässers und dem Ziel der Befischung ab. Das Verfahren basiert auf der Erzeugung eines elektrischen Feldes im Wasser. Der Strom fließt dabei zwischen zwei Polen, der Pluspol ist dabei am Fangkescher befestigt. Sobald das elektrische Feld aktiv ist, reagieren die Fische darauf, schwimmen auf die Stromquelle zu und werden kurzzeitig betäubt. In diesem Zustand können sie schonend mit dem Kescher eingesammelt werden. Bei sachgerechter Anwendung stellt dieses Verfahren für die Tiere nur ein geringes Risiko dar. Ein wesentlicher Vorteil der Elektrofischerei ist, dass nahezu alle Fischarten, unabhängig von Größe oder Alter, auf den Stromimpuls reagieren. Dadurch lässt sich ein breites Artenspektrum erfassen. Die gefangenen Tiere werden zur Bestandsaufnahme vermessen, gewogen, bestimmt und können nach Bedarf auch markiert werden. Nach kurzer Zeit erholen sie sich und werden anschließend wieder in ihren natürlichen Lebensraum ausgesetzt.
Reusenbefischung
Das Funktionsprinzip einer Reuse beruht darauf, dass Fische durch eine trichterförmige Öffnung, die sich zur Fangkammer hin verengt, hineingelockt werden. Einmal in der Kammer angekommen, finden sie in der Regel keinen Weg zurück und verbleiben darin. Bei der Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegsanlagen (FAH) wird die Reuse direkt in den Verlauf der Anlage eingebaut. Auf diese Weise wird sie kontinuierlich vom Wasser durchströmt. Die Fische, die dem Lockstrom folgen, schwimmen dabei selbstständig in die Reusenkammer hinein, ohne dass ein aktives Einfangen erforderlich ist. Abhängig von der jeweiligen Fischregion wird eine Reuse für mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten am oberen Abschnitt der Fischaufstiegsanlage positioniert. Die Reusen müssen so konstruiert sein, dass sie sämtliche aufsteigenden Fische, einschließlich sehr kleiner Individuen, schonend und ohne Verletzungen aufnehmen können. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Tiere bis zur nächsten Leerung der Reuse nicht entkommen können. Dabei gilt es, einen Kompromiss zu finden: Eine möglichst feine Maschenweite verbessert zwar die Rückhaltefähigkeit, erhöht jedoch auch das Risiko von Verklausungen. Um eine stress- und verletzungsfreie Erfassung der Fische zu ermöglichen, müssen die Reusen an den jeweiligen Standort angepasst werden. Die Reusen müssen täglich kontrolliert werden. Neben der Artbestimmung werden die Fische gemessen, gewogen und bei Bedarf markiert. Aufgrund der langen Befischung und des personellen Aufwands sind hohe Investitionen notwendig. Diese Methode ist für den Fang von nicht wandernden Fischen zur quantitativen Erfassung von Populationen grundsätzlich ungeeignet. Fangstatistik Auch die Erfassung und Nutzung von Fanginformationen von Fischer*innen ermöglicht die Überwachung von Fischbeständen und deren Lebensräumen. Zur Erfassung der Fangdaten von Angler*innen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Die mobile Fangzählung ist aufgrund des persönlichen Kontakts mit den Fischer*innen wahrscheinlich die genaueste, ist aber relativ arbeitsintensiv. Methoden, die auf die Meldung durch Dritte angewiesen sind, umfassen die Verwendung von Aufzeichnungen. Zu den Problemen bei der Verwendung von Fangdaten zählen die Schwierigkeit, den Bestand abzuschätzen, und die Tatsache, dass die Qualität von der Genauigkeit der aufgenommenen Daten abhängt. Diese Nachteile müssen gegen die Kosteneffizienz der Datenerhebung abgewogen werden.
Monitoring ohne Fischfang
Videomonitoring
Unterwasserkameras bieten die Möglichkeit, vorbeiziehende Fische vollkommen berührungsfrei zu erfassen. Mit Hilfe automatischer Auslösetechniken dokumentieren sie die Bewegungen einzelner Tiere sowie sämtlicher anderer sich bewegender Objekte im Erfassungsbereich, unabhängig davon, ob diese schwimmen oder treiben und in welche Richtung sie sich bewegen. Die Tiere werden dabei weder festgehalten noch in ihrer Bewegung gestört und bleiben dadurch vollständig stressfrei. Ausgestattet mit Bewegungssensoren beginnen die Kameras automatisch mit der Videoaufzeichnung, sobald Fische in den Erfassungsbereich gelangen. Dank integrierter Infrarotsensorik und LED-Lichtquellen ist der Betrieb auch bei schlechter Sicht, etwa durch Trübung des Wassers oder in der Nacht, zuverlässig möglich. Die Fischwanderung kann somit rund um die Uhr verfolgt werden. Durch die Anbindung an ein Online-System besteht jederzeit die Möglichkeit, aus der Ferne auf Geräteeinstellungen zuzugreifen oder aufgezeichnetes Videomaterial abzurufen. Bis vor kurzem erfolgte die zeitaufwendige Auswertung manuell. Mit der künstlichen Intelligenz (KI) gibt es jetzt die Möglichkeit, diese auf das Unterscheiden von Fischarten anhand von Fotos und Videoaufnahmen zu trainieren. So kann die KI umfangreiches Material in wenigen Tagen auswerten, während man früher Monate oder Jahre brauchte. Dem User bzw. der Userin werden danach Datensätze zur Verfügung gestellt, in welchen dokumentiert ist, zu welchem Zeitpunkt im Video welcher Fisch zu sehen war.
Hydroakustik
Die hydroakustische Erfassung von Fischbeständen erfolgt kontaktlos mittels Schallwellen und ermöglicht dadurch eine störungsfreie Beobachtung der Tiere, ein Fang oder physischer Eingriff ist nicht erforderlich. In der Hydroakustik wird zwischen aktiven und passiven Verfahren unterschieden. Passive Systeme zeichnen Schallwellen auf, die von den Fischen selbst oder von Umgebungsgeräuschen stammen, wobei sogenannte Hydrophone als Empfänger dienen. Aktive Methoden hingegen arbeiten mit künstlich erzeugten Schallimpulsen, die durch spezielle Sender, oft direkt an den Fischen befestigt, ins Wasser gesendet werden und deren Reflexion ausgewertet wird. Solche hydroakustischen Geräte sind besonders effektiv bei der Zählung von Fischen, zeigen jedoch die besten Ergebnisse in tiefen und wenig strukturierten Gewässern mit einer geringen Artenvielfalt. Zu den größten Nachteilen dieser Technologie zählen die hohen Anschaffungskosten sowie die begrenzte Fähigkeit, Fischarten eindeutig zu identifizieren. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann jedoch dabei helfen, die Artbestimmung auf Basis der gesammelten akustischen Daten zu verbessern.
eDNA
Umwelt-DNA (engl. environmental DNA, kurz eDNA) basiert auf dem Vorhandensein von DNA von Fischen in Wasserproben, die aus Schleim und Kot, der Ablösung von Zellen aus der Darmschleimhaut und der Zersetzung toter Fische stammt. eDNA wird aus Wasserproben extrahiert und in Verbindung mit artspezifischen, genetischen Markern verwendet. Anhand der nachgewiesenen eDNA-Fragmente lässt sich eine bestimmte Fischart nachweisen. Es gibt die Möglichkeit, mittels eDNA das Vorhandensein bzw. das Fehlen einer bestimmten Art festzustellen oder die Artenzusammensetzung zu untersuchen. Der Nichtnachweis artspezifischer eDNA-Fragmente in einer Flusswasserprobe bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das Fehlen der Zielart. Ebenso wenig wie ein positives Signal zwangsläufig das Vorhandensein der Art bedeutet, da die eDNA aus flussaufwärts gelegenen Gebieten transportiert worden sein könnte. Dennoch dürfte die Technik mit der Weiterentwicklung eine zunehmend wertvolle Ergänzung zu bereits etablierten Fangmethoden darstellen.
Die Wahl der Methode
Süßwasserfische bewohnen in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus eine Reihe von Lebensräumen, darunter Seen, Flüsse, Bäche, Feuchtgebiete, Flussmündungen und das Meer. Die Art und Weise, wie Süßwasserfische ihre Lebensräume zu verschiedenen Zeiten nutzen, erschwert die Wahl der am besten geeigneten Technik zusätzlich. Selbst die zuverlässigste Methode kann durch schlechtes Design, unzureichendes Verständnis der Annahmen und unsachgemäße Anwendung beeinträchtigt werden. Nicht alle Techniken eignen sich gleichermaßen gut zur Beantwortung einer bestimmten Fragestellung, und auch keine Methode ist für alle Erhebungen zum räumlichen Verhalten von Fischen anwendbar, da für alle Methoden art- und umweltspezifische Einschränkungen gelten. Auch der Zeitrahmen der Erhebung hat Einfluss auf die Methodenwahl, da sich einige Methoden besonders für Kurzzeiterhebungen eignen, während andere eher für Langzeiterhebungen geeignet sind. In diesem Zusammenhang muss immer ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit der gesammelten Informationen, der Dauer der Erhebung, der Anzahl der Fische, von denen relevante Informationen gewonnen werden können, dem Störungsgrad der Methode und der Verfügbarkeit von Ressourcen für die Erhebung gefunden werden. Die Wahl der besten Methode ist eine kumulative Entscheidung, die viele Faktoren berücksichtigt. Beispielsweise beeinflussen Standortbedingungen (Neigung, Wassergeschwindigkeit, Vegetation, Tiefe, etc.) die Wahl der Methode, ebenso wie die Selektivität des Fangs (Bei der Verwendung von Reusen werden nicht alle Fischgrößen gefangen, bei der Elektrobefischung hingegen schon).
Fazit
Zusammenfassend erfordert ein effektives Fischmonitoring eine sorgfältige Methodenauswahl, die sich nach den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gewässers und der Zielsetzung der Untersuchung richtet. Nur durch ein fundiertes Verständnis der Stärken und Grenzen jeder Methode können Gewässerökolog*innen aussagekräftige Daten über Fischbestände erheben und damit einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Management aquatischer Ökosysteme leisten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Monitoring-Techniken verspricht zudem, zukünftig noch präzisere und schonendere Bestandserhebungen zu ermöglichen.