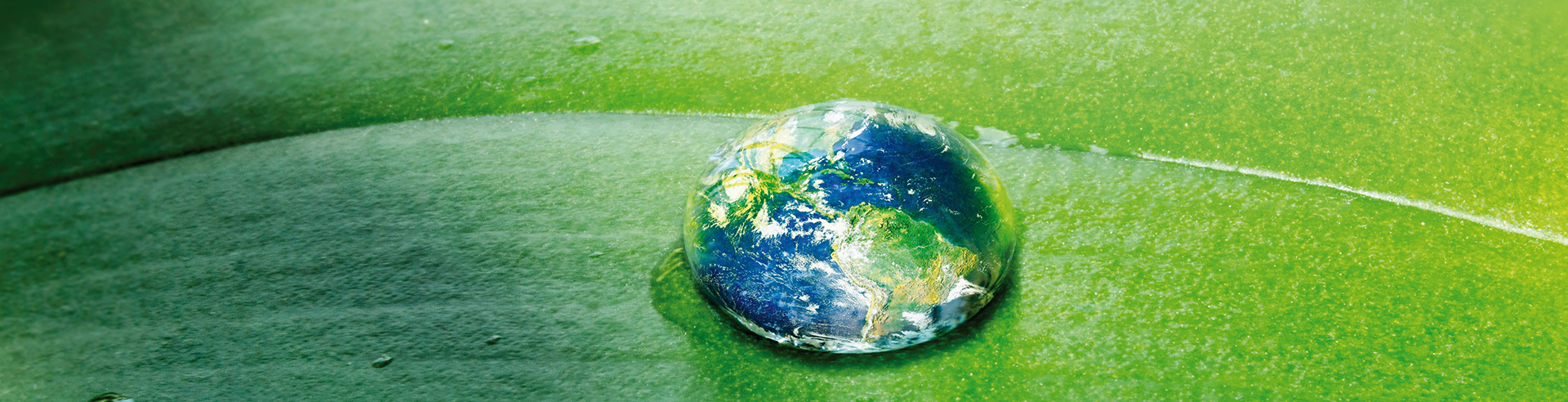CO2-Entnahme: Notwendigkeit und Herausforderung
In einem Policy Paper des gemeinnützigen Think Tanks Energy Watch Group wird argumentiert, dass die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre – neben der Treibhausgasneutralität und der Anpassungen an neue klimatische Bedingungen – die dritte Säule einer nachhaltigen Klimapolitik bildet. Die Begründung: Der Ausstoß von Treibhausgasen – vorrangig CO2 – sorgt dafür, dass kurz- wellige Sonnenstrahlung in die Atmosphäre eintreten kann, langwellige Wärmestrahlung jedoch absorbiert und in der Atmosphäre belassen wird. Als Konsequenz davon steigt die globale Temperatur an – wie in einem Glashaus. Wollen wir die Erderwärmung also beschränken, reicht es nicht, kein CO2 mehr an die Atmosphäre abzugeben. Die Emissionen würden die Erde noch etwas weiter aufheizen und würden dann sehr langsam über viele, viele Jahrzehnte auf natürliche Weise z.B. in Ozeanen gespeichert werden. Nein, um das Ausmaß der Erderwärmung in Schach zu halten, muss der CO2- Anteil in der Atmosphäre gesenkt werden.
Entgegen den Vorwürfen, Carbon-Capture-Bemühungen dienten lediglich als Ablenkung von Maßnahmen zur Emissionsreduktion um ein „weiter wie bisher“ zu er- möglichen, wird eine CO2-Entnahme als Zusatzmaßnahme, nicht als Alternative, aufgezeigt. Konkret legt die Studie eine Reduktion der CO2-Konzentration von derzeit über 425 ppm („parts per million“) auf maximal 350 ppm nahe, was zwar über dem vorindustriellen Wert von 280 ppm liegt, aber die Temperaturerhöhung immerhin auf etwa 1 °C begrenzen würde. Momentan liegt die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur bei mehr als +1,5° Celsius. Als Anreiz dient ein Blick in die Geschichte: Das letzte Mal, als vergleichbar viel CO2 in der Atmosphäre war wie jetzt, war vor ca. 3 Millionen Jahren.
Die Autor*innen rechnen vor, dass dazu 450 Gigatonnen – also 450.000.000.000 Tonnen – Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt werden müssen, was ca. 1.700 Gigatonnen CO2 entspricht.
Diese Summe errechnet sich aus 150 Gigatonnen Kohlenstoff, die direkt aus der Atmosphäre entnommen werden müssen, und 100 Gigatonnen Kohlenstoff, die wir bis zum Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2045 noch ausstoßen werden, wobei letzteres insbesondere aufgrund der geopolitischen Lage durchaus optimistisch erscheint. Dazu kommen jeweils 100 Gigatonnen Kohlenstoff, die durch diese Veränderung sowohl von den Meeren als auch von Pflanzen an Land wieder an die Atmosphäre abgegeben werden. Denn die Löslichkeit von CO2 in Wasser und damit die CO2-Aufnahmeleistung der Ozeane hängt direkt von der CO2-Konzentration der Atmosphäre ab. Sinkt die CO2-Konzentration der Atmosphäre, fällt dadurch deren Partialdruck, wodurch CO2 aus den Meeren entweicht. Gleichzeitig erschwert eine sinkende CO2-Konzentration es Pflanzen, Kohlenstoff aufzunehmen und zu wachsen, wodurch sie weniger CO2 binden. Zusammen mit der anhaltenden Nutzung fossiler Brennstoffe verdreifacht sich dadurch das zu erreichende CO2-Entnahmeziel.

Lösungsansatz Ocean-Farming
Die Notwendigkeit der CO2-Entnahme liegt auf der Hand, und auch das Ausmaß der Herausforderung ist klar definiert. Wie aber soll sich diese Herausforderung bewältigen lassen? Laut den Autor*innen: mit Algen. Die Idee klingt zwar ungewöhnlich, hat aber einen Präzedenzfall – das Azolla-Ereignis. Denn die Massevermehrung und anschließende Sedimentierung des Algenfarns Azolla vor 49 Millionen Jahren entnahm zwischen 900 und 3,500 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre – damals allerdings über einen Zeitraum von mehreren Hunderttausend Jahren. Statt Azolla wollen die Autor*innen auf Sargassum setzen, eine schnell wachsende Braunalge, die ihre Biomasse innerhalb von zehn Tagen verdoppeln kann und im getrockneten Zustand zu 30% aus Kohlenstoff besteht. In der nach ihr benannten Sargassosee im Nordwestatlantik bildet die Alge zwei bis drei Meter dicke Algenteppiche nahe der Oberfläche, die Lebensraum und Rückzugsorte für Meeresbewohner – von Fischen bis zu Meeresschildkröten – bieten. Auch der europäische Aal hat hier seine Laichgründe.
Deswegen schlägt die Studie vor, Sargassum in großem Stil auf riesigen Plantagen in den fünf subtropischen Wirbeln anzubauen. Diese Strategie bietet mehrere Vorteile. Erstens ermöglichen die einfache Aufzucht, das schnelle Wachstum und die riesige verfügbare Fläche – immerhin machen die Wirbel um die 50% der Erdoberfläche aus – zumindest theoretisch das Erreichen des 450-Gigatonnen-Ziels, was mit anderen Mitteln wie CO2 Speicherung im Untergrund, Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren etc. nur schwer vorstellbar scheint.
Zweitens wären Nutzungskonflikte und ökologische Konsequenzen vermutlich begrenzt, da die Wirbel aufgrund ihres nährstoffarmen Oberflächenwassers als „Wüsten der Ozeane“ gelten. Der gezielte Anbau von Algen könnte hier neue Lebensräume schaffen und so einen ökologischen Mehrwert bieten.
Drittens sind die benötigten Basistechnologien teilweise schon an anderer Stelle – beispielsweise bei Offshore-Windanlagen oder Tiefsee-Bohrinseln – im Einsatz. Nährstoffreiches Tiefenwasser müsste zwar mit Rohren an die Oberfläche gepumpt werden, der natürliche Dichteunterschied zwischen den Wasserschichten, die unterschiedliche Temperaturen und Salzgehalte aufweisen, könnte dabei allerdings als Antrieb dienen, sobald der Prozess erst einmal in Gang gesetzt ist. Mit einer Doppelrohrkonstruktion, bei der kaltes Tiefenwasser innen aufsteigt und warmes Oberflächenwasser außen abfällt, könnte außerdem ein Wärmeaustausch angeregt und ein neuerliches Absinken des nährstoff- reichen Tiefenwassers, welches beinahe unbegrenzt vorhanden ist, verhindert werden.
Gleichzeitig zeigt die Studie auch Herausforderungen und Risiken auf. Die Finanzierung eines solchen Projekts würde beispielsweise erhebliche Mittel in Anspruch nehmen. Die Autor*innen verweisen jedoch auf weitergehende Anwendungsmöglichkeiten der Algen mit langfristiger Kohlenstoffbindung in der Bauindustrie, in chemischen Prozessen oder als Biokunststoff, sowie auf Potenziale als Biokraftstoff oder Futtermittel, als Alternativen zur Verpressung und Versenkung der Algen. Ein Markt für Großalgen müsste sich allerdings erst etablieren.
Eine Nutzung der neu entstehenden Lebensräume als Aquakulturen und ein größerer Markt für CO2-Zertifikate könnten zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit des Konzepts beitragen, doch zumindest am Anfang werden staatliche Subventionen wohl eine größere Rolle spielen müssen. Außerdem bleiben wie bei jedem Eingriff in die Natur zum Teil noch unabsehbare ökologische Risiken, wie etwa Sorgen bezüglich der Auswirkungen der Zersetzung von Algen im Tiefenwasser, welche dort zu Versauerung und Sauerstoffmangel beitragen und so Schäden verursachen oder gar „Todeszonen“ hinterlassen könnte. Auch besteht die Gefahr, dass Sargassum-Matten an Küsten angespült werden und dort die Wirtschaft oder den Tourismus beeinträchtigen.
Fazit
Geoengineering bezeichnet das vorsätzliche Eingreifen in biogeo- chemische Kreisläufe der Erde – mit dem Emissionsausstoß und der damit einhergehenden Erderwärmung als prominentestes Beispiel. Ocean-Farming als Methode zur CO2-Bindung könnte als positives Beispiel aktiv gegensteuern und uns den Klimazielen näher bringen. Dabei müsste man sich zunächst vor allem der Debatte „Klimaschutz versus Umweltschutz“ stellen. Darüber hinaus darf man die regulatorischen, gesetzlichen und logistischen Hürden nicht unterschätzen. Wenn klimafreundliche Lösungen schon innerstaatlich oft vor enorme bürokratische und regulatorische Hausausforderungen gestellt werden, liegt die großflächige Nutzung von Ocean-Farming sehr wahrscheinlich noch in weiter Ferne.