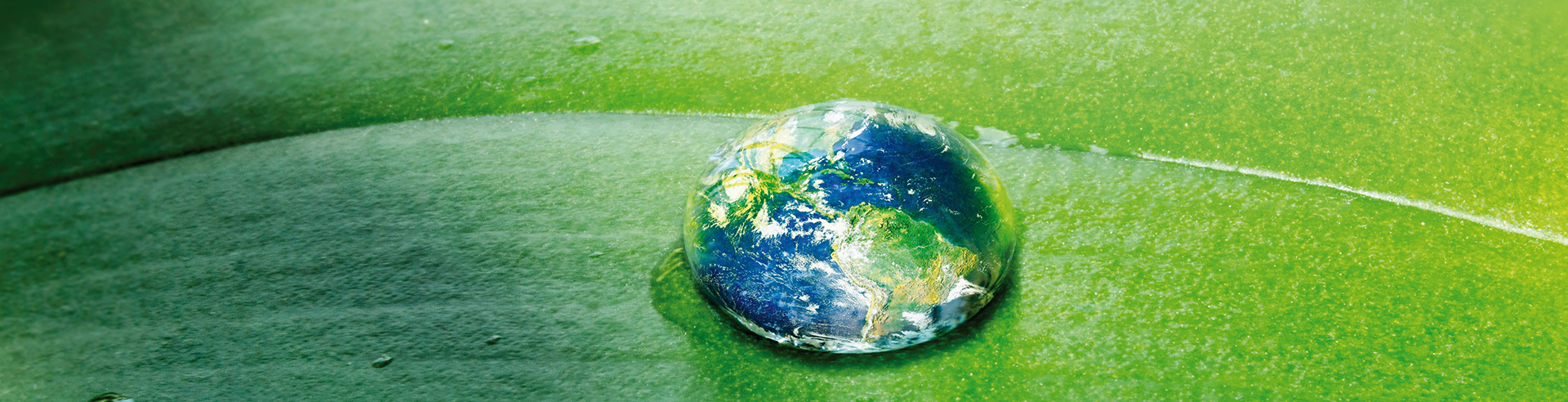Ökologische Risikoabschätzung anhand von Staubereichen
Die Studie mit dem Titel „Sedimentmanagement, ökologischer Zustand und Handlungsempfehlungen hinsichtlich Kleinwasserkraftanlagen in Österreich“ von Patrick Leitner, Peter Flödl, Wolfram Graf und Christoph Hauer wurde im Februar 2025 im Fachjournal Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft veröffentlicht. Die Forscher untersuchten den ökologischen Zustand von Staubereichen bei Kleinwasserkraftanlagen in den unterschiedlichen Bioregionen Österreichs. Anhand von Makrozoobenthosdaten, also der Zusammensetzung wirbelloser Kleintiere am Gewässergrund, sowie hydromorphologischen Parametern wie Fließgeschwindigkeit und Korngröße, analysierten sie, unter welchen Bedingungen ein guter ökologischer Zustand erhalten bleibt und ab wann Handlungsbedarf besteht. Ziel war, praxisnahe Kriterien zur Bewertung und Verbesserung der ökologischen Qualität in Staubereichen zu entwickeln, eine Thematik, die für Kleinwasserkraftbetreiber*innen ebenso relevant ist wie für Behörden und Planer*innen.
Jeder Eingriff in die Natur kann negative Folgen haben, wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Für die Kleinwasserkraft sind dies z.B. Fischwanderhilfen, um der Unterbrechung des Fließkontinuums entgegenzuwirken, die Abgabe einer ausreichenden Menge Restwasser, und vieles mehr. Zu all dem gibt es konkrete Empfehlungen. Für die ökologische Aufwertung von Staubereichen aus sedimentdynamischer Perspektive fehlen solche Empfehlungen jedoch. Ziel der Studie war, den ökologischen Zustand von Staubereichen in verschiedenen österreichischen Bioregionen zu bewerten und mit abiotischen Parametern wie Fließgeschwindigkeit und Korngröße in Beziehung zu setzen.
Untersuchungsdesign und Methodik
Im Rahmen der Studie wurden 16 watbare Staubereiche in acht verschiedenen Bioregionen untersucht. In jedem Staubereich wurden fünf Transekte (Beobachtungspunkte entlang einer geraden Linie) beprobt. Diese Transekte reichten vom Bereich direkt unterhalb des Wehres bis in den ungestauten Oberlauf. Zusätzlich wurden in den freien Fließstrecken stromaufwärts Proben entnommen, um die Qualität der Mesohabitate zu analysieren. Mesohabitate sind abgegrenzte Bereiche innerhalb eines Bachs, die sich durch eine einheitliche Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Substratbeschaffenheit auszeichnen. Beispiele für Mesohabitate sind Flachwasserbereiche, Kolke, Rinnen oder Mündung eines Zubringers. Riffle- (schneller- fliesende, flache Bereiche) und ein Pool-Mesohabitat (tiefere, ruhigere Bereiche) wurden separat beprobt. Die biologischen Proben wurden mit der AQEM-Methode (ein Bewertungssystem, das der Einstufung eines Gewässerabschnitts in eine ökologische Qualitätsklasse dient) im Rahmen eines Multi-Habitat- Samplings entnommen. Zeitgleich wurden vor Ort die dominierenden Substrattypen, die Wassertiefe, die Entfernung vom Ufer, die mittlere sowie bodennahe Fließgeschwindigkeit und das Ausmaß der Kolmation (Ablagerung von Schwebstoffen auf der Fließgewässersohle) erhoben. Die biologische Bewertung des ökologischen Zustands erfolgte mittels Makrozoobenthos gemäß der Screening-Methode. Dabei kamen die Module „Allgemeine Degradation“ und „Organische Belastung“ zum Einsatz. Die Einstufung erfolgte mit der Software ECOPROF (Entwickelt zur klassischen saprobiologischen Gewässergüteanalyse – biologisch-ökologischen Gewässerbeschaffenheit).

Ergebnisse
Die frei fließenden Referenzstrecken, insbesondere die Stromschnellen-Bereiche, wurden durchwegs als ökologisch „sehr gut“ oder „gut“ eingestuft. Zwei Staubereiche der 16 untersuchten Abschnitte, nämlich an der Gurgl und an der Schwarza bei Schwarzau, zeigten keinen Unterschied im ökologischen Zustand im Vergleich zwischen Referenz- und Staubereich auf. Drei weitere Standorte wiesen eine geringe Zustandsverschlechterung von sehr gut auf gut auf, was jedoch keine Maßnahmen erforderlich macht. Die Mehrheit der Staubereiche zeigte jedoch eine signifikante Verschlechterung des ökologischen Zustands bis in den Bereich des Handlungsbedarfs. Dies traf an sechs Untersuchungsabschnitten bereits auf Pool-Habitate der Referenzstrecken zu. Eine Ausnahme bildete die Taffa, die sowohl im Staubereich als auch im Oberlauf im Handlungsbedarf lag. In einzelnen Fällen zeigte sich trotz einer Verschlechterung der Zustandsklasse im oberen Staubereich eine Verbesserung im mittleren Abschnitt oder unmittelbar oberhalb des Wehrs. Mögliche Ursachen sind organische Ablagerungen wie Laubansammlungen, die kurzfristig als Ersatzhabitate für die Fauna dienen können.
Regionale Unterschiede
Die Studie bestätigt, dass Fließgeschwindigkeit, Korngröße und Sauerstoffgehalt im Gewässerbett zentrale Einflussgrößen für die Zusammensetzung von Makrozoobenthos und somit für die Bewertung des ökologischen Zustands sind. Die Analyse offenbarte dabei deutliche Unterschiede zwischen den Bioregionen. Diese Unter- schiede sind auf die natürliche Substratzusammensetzung der vor- herrschenden Gewässertypen der Bioregionen zurückzuführen. Im Alpenvorland dominieren haupt- sächlich Kiesfraktionen, während im Granit- und Gneisgebiet vor allem Grobsand und Feinkies zu finden sind. Für das Alpenvorland er- gaben sich bioregionsspezifische Zustandskurven, die zeigen, dass bei Fließgeschwindigkeiten unter 0,15 m/s in Staubereichen in der Regel Handlungsbedarf besteht. Die optimale Geschwindigkeit für einen guten Zustand liegt hier bei etwa 0,4 m/s. In anderen Bioregionen variierten die Ergebnisse deutlich. So besteht beispielsweise im Granit- und Gneisgebiet auch bei höheren Fließgeschwindigkeiten Handlungsbedarf. In Bergrückenlandschaften führte eine höhere Fließgeschwindigkeit sogar zu einer Verschlechterung.
Der Zusammenhang zwischen Korngröße und Fließgeschwindigkeit zeigt sich in den untersuchten Stauabschnitten erst ab dem MQ (= mittlerer jährlicher Abfluss) mehr oder weniger deutlich. Daher ist auch die Reaktion der Fauna stärker an den Parameter Korngröße als an die Fließgeschwindigkeit gekoppelt. Die Ausprägung dieses Zusammenhangs variiert je nach Stauraumtyp. In Tieflandgewässern ist oft ein klarer Übergang von Grobkorn zu Feinsediment im Längsverlauf erkennbar, während dieser in anderen Bioregionen schwächer ausfällt. Ist der Gradient gering, erfolgt trotz sinkender Fließgeschwindigkeit kaum Feinsedimentablagerung, entsprechend zeigt die Fauna keine signifikanten Unterschiede zwischen dem frei fließenden Abschnitt und dem Staubereich.
Es lässt sich auch feststellen, dass sich der ökologische Zustand im flussabwärts gelegenen Stauraum nicht weiter verbessert, sofern bereits in den oberhalb der Stauwurzel gelegenen, frei fließenden Pool- und/oder Riffle- Habitaten Handlungsbedarf besteht. Das bedeutet, dass eine bestehende (hydro-)morphologische oder saprobielle Vorbelastung bis zur Wehranlage nachwirkt. Ein weiterer Befund betrifft den Einfluss des Erhebungszeitraums. Ereignisse wie Hochwasser können die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften erheblich verändern. Der genaue Untersuchungszeitpunkt dürfte daher eine wesentliche Rolle spielen.
Schlussfolgerung
In einigen Bioregionen kann die eigendynamische Entwicklung von Staubereichen bei Kleinwasserkraftanlagen den ökologischen Zustand des Makrozoobenthos verbessern und sollte als alternative Maßnahme zu baulichen Eingriffen berücksichtigt werden. Zentrale Faktoren sind eine funktionierende Sedimentdynamik und ein intaktes Sedimentkontinuum. Die Screening-Methode erwies sich als geeignet, um faunistische Muster und abiotische Bedingungen über eine grobe Zustandsabschätzung zu verknüpfen. Da sich Staubereiche durch Hochwasser oder Eingriffe wie Spülungen stetig verändern, ist der Zeitpunkt der Probenahme entscheidend. Eine einheitliche Festlegung des Erhebungszeitraums erscheint daher notwendig. Die Ergebnisse zeigen, dass eine erste ökologische Risikoabschätzung anhand von Standort, Fließgeschwindigkeit und Substratstruktur mittels Substratkartierung und einfacher Verfahren zur Bestimmung der Fließgeschwindigkeit vorab möglich ist. Unsicherheiten in der Prognose aufgrund typologischer Besonderheiten sollten aber individuell beurteilt werden. Für Betreiber*innen von Kleinwasserkraftanlagen bedeuten diese Ergebnisse, dass mit überschaubarem Aufwand durch physikalisch-morphologische Parameter eine fundierte Vorauswahl für potenzielle ökologische Maßnahmen getroffen werden kann. Da sich der ökologische Zustand unterhalb eines Staubereichs nicht verbessert, wenn bereits im Oberlauf ein schlechter Zustand vorliegt, erscheint eine gesamthafte Betrachtung entlang der Gewässerstrecke erforderlich.
Zur Studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s00506-025-01115-1